Schwefel ist nicht der Bösewicht
Nadja Bleuler hat sich im Rahmen ihrer Weinakademiker-Diplomarbeit mit den Bereitungsmethoden von Naturweinen beschäftigt. Ihre Fragestellung lautete: Wird dabei die Entstehung von Stoffen begünstigt, die zu Unverträglichkeitsreaktionen führen?
Nach dem Genuss von Wein geht es manchen Menschen körperlich schlecht – und zwar ohne dass sie dies auf einen übermässigen Alkoholkonsum zurückführen könnten. Als Ursache wird vielfach Schwefel vermutet. «Oft wird argumentiert, dass Naturwein bekömmlicher sei, weil bei der Weinbereitung kein Schwefel zugesetzt wird», sagt Nadja Bleuler, die sich in ihrer Diplomarbeit mit den Bereitungsmethoden von Naturweinen auseinandergesetzt hat. «Ich fand das eher irritierend und wollte dem auf den Grund gehen.» Im Rahmen ihrer Recherche sei klar geworden, dass Allergien auf Sulfit – also Schwefel – eher selten seien. Warum aber klagen dennoch viele Leute nach dem Konsum von Wein – sowohl von konventionell erzeugtem wie von Naturwein – über Symptome wie Hautrötungen, verschnupfte Nase, Durchfall, Magen- oder Darmkrämpfe, Erbrechen, Herzrasen und Juckreiz? Als Ursache werden die so genannten biogenen Amine vermutet. So korrelieren laut Bleuler die typischen Histamin-Intoleranzsymptome mit häufig genannten Wein-Unverträglichkeitsreaktionen. Histamine gehören zur Gruppe der biogenen Amine und kommen natürlicherweise in vielen Lebensmitteln vor (siehe Definition rechts). Da Alkohol dazu führt, dass die biogenen Amine leichter in die Blutbahn gelangen, ist Histamin in alkoholischen Getränken wirksamer als in Nahrungsmitteln. Wenn dann gleichzeitig zum Wein auch noch Nahrungsmittel wie etwa Käse konsumiert werden, die ebenfalls biogene Amine enthalten, könnten Wechselwirkungen die Unverträglichkeitsreaktionen verstärken.
Mehr biogene Amine in Naturweinen?
Für ihre Diplomarbeit ging Nadja Bleuler nun der Frage nach, ob gewisse Aspekte in der Bereitung von Naturweinen die Entstehung dieser unerwünschten Stoffe begünstigen. Dabei hat sie Faktoren im Rebberg, Umweltfaktoren und Faktoren im Keller unter die Lupe genommen. Zu Ersteren gehören die klimatischen Bedingungen. «Insbesondere bei Rotweinen aus heissen Gebieten ist das Risiko für die Entstehung von biogenen Aminen generell erhöht», sagt Nadja Bleuler. Dies liege daran, dass die Trauben oft gut gereift seien und die Weine dementsprechend tiefere Säure- und höhere pH-Werte aufweisen würden. Wenn der Wein auch noch einen hohen Alkoholgehalt habe, sei das Risiko für Unverträglichkeiten höher. Hier spiele wiederum eine Wechselwirkung zwischen Alkohol und biogenen Aminen mit hinein. «Das Positive an Naturwein ist in diesem Zusammenhang, dass er oft früher geerntet wird und frischer ist als konventioneller Wein», so Bleuler. Dieser Trend zu tieferen pH-Werten bei Naturweinen würde das Risiko für Aminbildung mindern.
Spontaner Säureabbau als Risikofaktor
Ein entscheidender Faktor für die Aminbildung im Keller, also bei der Weinbereitung, ist der biologische Säureabbau (BSA), auch bekannt als «malolaktische Gärung». Diesen Prozess lassen Naturwinzer in der Regel spontan ablaufen. Der spontane BSA stellt den Hauptrisikofaktor für die Entstehung biogener Amine dar – vor allem bei hohen pH-Werten. Hinzu komme der anschliessende Verzicht oder die nur minimale Zugabe von Schwefel. Auch dies könnte dazu führen, dass Mikroorganismen im Wein aktiv bleiben und biogene Amine bilden.
Laut Nadja Bleuler fehlen derzeit noch Studien, welche die Aminbildung in Naturweinen explizit untersuchen. Schlussendlich komme es aber auf die Gesamtheit der Bedingungen an, unter welchen ein Wein erzeugt werde. Daher könne weder pauschal gesagt werden, dass Naturweine gesünder seien, noch dass die Bereitungsmethoden von Naturweinen generell die Entstehung von unerwünschten Stoffen fördern würden. Sie plädiert daher dafür, dass situativ Massnahmen ergriffen werden, wenn eine erhöhte Tendenz zur Aminbildung erkennbar ist. Eine solche könnte die Verwendung selektionierter Hefen und Milchsäurebakterien sein, die sich als nicht aminbildend erwiesen haben. Auf der anderen Seite empfiehlt sie, auf solche Massnahmen zu verzichten, wenn das Risiko der Aminbildung tief sei.
Glossar
Biogene Amine
Biogene Amine entstehen beim Verderb von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Wurst oder auch bei mikrobiell hergestellten Lebensmitteln wie Wein, Käse, Sauerkraut oder Salami. So etwa beim Reifen von Käse, wobei lange gereifter Käse stärker belastet ist. Zu den biogenen Aminen gehört unter anderem Histamin. In höheren Dosen sind biogene Amine für Menschen toxisch.
Histamin
Gehört zu den biogenen Aminen und ist eine chemische Substanz, die in Zellen von Pflanzen, Tieren, Menschen und Mikroorganismen gebildet werden kann. Gewisse Nahrungsmittel wie Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Tomaten, Schalen- und Krustentiere oder Weisswein können eine Freisetzung von körpereigenem Histamin bewirken.
Naturwein
Bisher fehlt eine gesetzliche Definition davon, was als Naturwein bezeichnet werden darf. Allerdings besteht in der Branche eine gewisse Einigkeit darüber, welche Mindestanforderungen Naturweine erfüllen müssen. Dazu gehören ein möglichst naturnaher Weinbau (biologischer oder biodynamischer), Handlese, kein Hinzufügen von Hefen, das Zulassen von biologischem Säureabbau, kein steriles Filtrieren oder Pasteurisieren und keine Zugabe von Zusätzen (Ausnahme: Sulfite, maximal 70 mg/l).
Text: Nicole Hättenschwiler
Bilder: Shutterstock, Marion Nitsch

Die Ökonomin Nadja Bleuler ist in der Finanzbranche tätig und hat 2017 das WSET-Diplom für den Weinakademiker-Titel erhalten. Der Titel ihrer Diplomarbeit lautet: «Der Trend zu Naturweinen und mikrobiologische Aspekte der Weinqualität: Begünstigen die Bereitungsmethoden von ‹Naturweinen› die Entstehung biogener Amine?»
Könnte dir auch gefallen
Versuchung auf Rädern
Mrz. 2025
In der Schweizer Gastronomie trifft man den Dessertwagen selten an. Dabei gibt es handfeste Argumente, die für ihn sprechen – wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind.
Trends, Herausforderungen und Freuden im neuen Jahr
Jan. 2025
Zum Jahresstart haben wir sechs führende Köpfe der Gastronomie und Hotellerie gefragt, welche Herausforderungen und grosse Trends 2025 prägen werden und worauf wir uns freuen können.
«Der Küchenchef hat keine Freude an mir»
Dez. 2024
Seit rund zehn Jahren ist Spitzenkoch Pascal Schmutz als Berater tätig. Konzipiert, setzt um und zieht weiter. Wie funktionieren solche Engagements? Und wann wird der Seeländer wieder sesshaft?

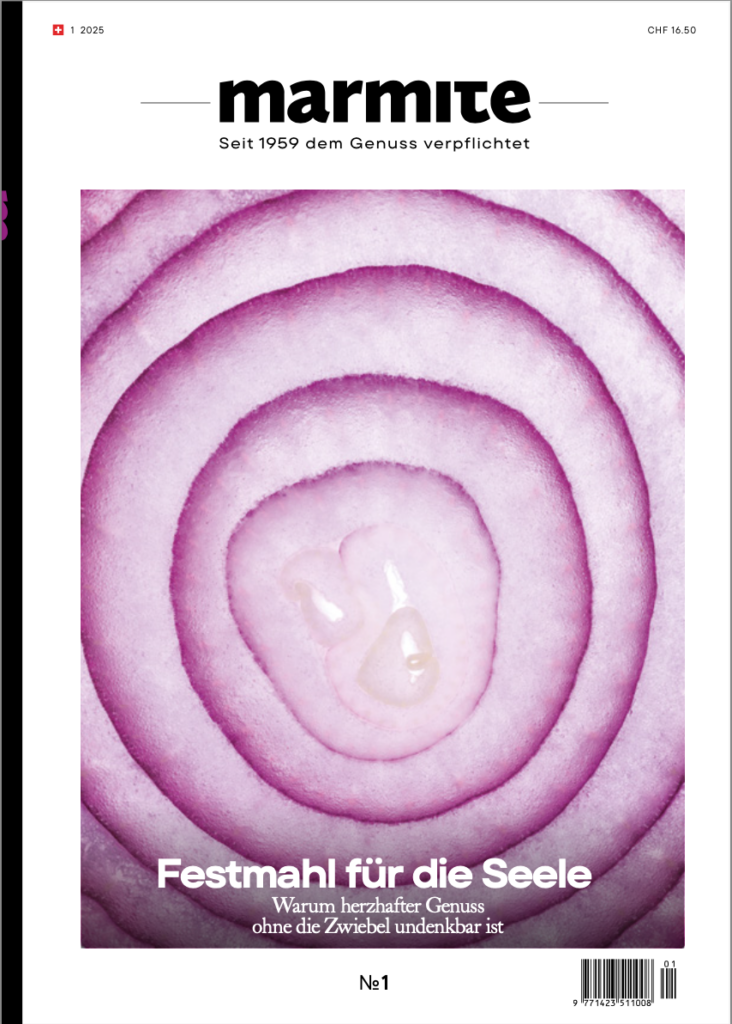
Profis profitieren mit dem Kombiabonnement
Wir bieten Inhalt für alle. Bestellen Sie noch heute Ihr Jahresabonnement!
Jetzt bestellen

